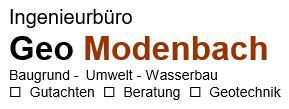Grundsätzlich trägt der Bauherr das Baugrundrisiko. Nach DIN 18299 muss er in der Leistungsbeschreibung insbesondere die „Bodenverhältnisse, den Baugrund und seine Tragfähigkeit sowie Ergebnisse von Bodenuntersuchungen“ angeben. Allerdings schuldet der Architekt in seiner Entwurfsplanung die Beurteilung des Baugrundes.
Für die Gründung eines Gebäudes sind die Eigenschaften des Baugrunds (Fundamente) von größter Wichtigkeit. Dazu gehört die Tragfähigkeit, also die Fähigkeit des Baugrundes oder Bodens, Lasten aus dem Bauwerk aufzunehmen, ohne dass es dabei zu wesentlichen Setzungen oder schlimmstenfalls einem Grundbruch kommt. Durch einen Grundbruch kann das Gebäude sogar einstürzen.
Der Baugrund setzt sich aus verschiedenen Bodenschichten und Bodenarten zusammen. Außerdem kann Grundwasser bzw. Schichtenwasser anstehen.
Die Bodenarten und Bodenklassen bestimmen die Eigenschaften des Baugrundes. Regional und lokal können diese sehr stark variieren. Dies wird einerseits durch die geologische Entstehung, aber auch durch anthropogene Einflüsse bedingt.
Die Eignung eines Baugrundes ist deswegen vor einer Baumaßnahme unbedingt durch Baugrunduntersuchungen abzuklären. Das Baugrundgutachten gibt dann auch Auskunft über geeignete Maßnahmen bei einem schlechten Baugrund oder Boden und auch zur Abdichtung gegen Grund- und Schichtenwasser.
Beispiel für einen risikoreichen Baugrund:
Der schiefe Turm von Suurhusen

Der Kirchturm wurde im Jahr 1450 an die seit Mitte des 13. Jahrhunderts existierende und zuvor turmlose Kirche mit einer Grundfläche von 32 × 9,35 Metern angebaut. Er wurde auf einem Fundament aus Eichenstämmen über Moorboden errichtet. 1885 wurde erstmals bemerkt, dass sich der Kirchturm zur Seite neigt. Aufgrund der Entwässerung der umliegenden Ländereien sank der Grundwasserspiegel ab, was dazu führte, dass die bisher im Grundwasser konservierten Eichenstämme zu modern begannen. (Quelle: Wikipedia)